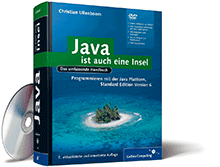19.13 Internationalisierung 

Im Zuge der weltweiten Verbreitung des Internets werden die Angebote immer internationaler. Eine Anleitung zum Basteln von eigenen Klostopfern, die vor Jahren nur in Englisch auf der Anbieterseite zu finden war, ist mittlerweile so internationalisiert bzw. lokalisiert wie die nationalen Zeitungen. Java als plattformunabhängige Sprache darf sich natürlich nicht an eine Landessprache binden und bietet über die Locale-Klasse mittels unterschiedlicher Formatierungsklassen vielfältige Ausgabemethoden an.
Wenn wir nun Webseiten über Servlets erstellen, gilt es, zwei Dinge zu beachten: Zunächst müssen wir erkennen, in welcher Anfragesprache wir den Auftrag erhielten. Danach müssen wir unsere generierte Seite den Ländereigenschaften anpassen. Dies kann in HTTP 1.1 durch die Sprache und die Kodierung geschehen.
19.13.1 Die Länderkennung des Anfragers auslesen 

Bei einer Seitenanfrage schickt der Client eine Länderkennung automatisch zum Server, die wir auslesen können. Sie sitzt im Header Accept-Language und hat etwa folgendes Format:
Accept-Language: de, en
Dies zeigt an, dass als Erstes Deutsch gesendet werden soll. Als Alternative ist aber auch Englisch erlaubt. Um an diese Kennung zu gelangen, bietet die Klasse HttpServletRequest die Methode getLocale() an, die ein Locale-Objekt liefert. Wie wir sehen, kann es auch mehrere Präferenzen geben. getLocale() liefert dann die erste eingestellte Sprache. Um an alle Sprachen zu gelangen, liefert getLocales() eine Enumeration von Locale-Objekten. Erinnern wir uns an das Servlet HeaderNames. Dies ergab beim Internet Explorer nur einen Spracheintrag. Der Vorteil der Methoden besteht darin, Accept-Languages nun nicht mehr selbst auslesen und interpretieren zu müssen.
19.13.2 Länderkennung für die Ausgabe setzen 

Der nächste Schritt besteht nun darin, die über getLocale() gefundene Länderkennung auch für die Ausgabe zu nutzen. Es ist leicht zu erraten, dass dazu die Methode setLocale(Locale) auf der Klasse ServletResponse deklariert ist. Sie setzt einen Content-Language-Header und eine entsprechende Zeichenkodierung über Content-Type, dessen Bedeutung wir in Kürze kennenlernen werden. Die Befehle sind in der aufgezeigten Reihenfolge auszuführen:
res.setContentType( "text/html" ); Locale locale = req.getLocale(); res.setLocale( locale ); PrintWriter out = res.getWriter();
19.13.3 Westeuropäische Texte senden 

Wird als Sprache eine westeuropäische wie Deutsch, Englisch oder Schwedisch erkannt, so sind Sonderbuchstaben definiert, die nicht unbedingt im 7-Bit-ASCII-Alphabet vorkommen, etwa Umlaute. Diese Zeichen werden in HTML durch eine Sonderkennung nach folgendem Muster benannt: ein Und-Zeichen (&), der Name und ein Semikolon. So ergibt
½×½=¼
die Ausgabe ½. Deutsche Sonderzeichen sind zum Beispiel ä (ä), &zlig; (ß).
Für jeden dieser benannten Einträge definiert der HTML-Standard auch Dezimalzahlen, die den Zeichenpositionen im Latin-1-Zeichensatz (ISO-8859 – 1) entsprechen. Die Schreibweise ist der der benannten Einträge ähnlich. An Stelle des Namens folgt hinter einem Hash (#) der Hexadezimalwert. So besitzt das Copyright-Zeichen etwa die HTML-Kennung ©, wobei der Name © lautet.
Von Nachteil bei diesen Kodierungen ist es, dass sie zwar für HTML gut funktionieren, aber bei der Textausgabe die Kennungen sichtbar werden. Eine Lösung ist im Unicode-Standard gefunden worden, der den Wertebereich sogar noch erheblich ausdehnt.
Unicode-Zeichen
Der Unicode-Standard definiert in der Version 2.0 genau 38 885 Zeichen. Die ersten 128 Zeichen entsprechen dem Latin-1-Standard (ISO-8859 - 1). Das soeben vorgestellte Zeichen für das Copyright liefert demnach die Hexadezimal-Repräsentation von 169, und dies ist \u00A9.
Immer dann, wenn Unicode-Zeichen dem HTML-Strom übergeben werden, ist eine Zeichensatzkodierung mitzuliefern. Dazu müssen wir im Header für den Content-Type noch eine weitere Angabe eintragen, die wie folgt aussieht:
ContentType: text/html; charset=UTF-8
An der Zeichenkodierung UTF-8 erkennt nun der Browser, dass er die Daten nicht als einzelne Bytes interpretieren darf, sondern eine Interpretation vornehmen muss.
Einmal gesetzt, können weitere Unicode-Zeichen folgen, sofern dies die Anzeigeeinheit des Browsers unterstützt und das Betriebssystem die Zeichensätze bereitstellt. Hier ein Programm, das erst das Copyright-Zeichen und dann das griechische Alphabet ausgibt.
Listing 19.20 greekAndUnicode.jsp
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>
<%= '\u00a9' %>
<%
for ( char c = '\u0391'; c <= '\u03A9'; c++ )
out.print( c );
%>Ohne die explizite Angabe von UTF-8 entstünden keine korrekten Zeichen, sondern – zumindest bei den griechischen Zeichen – nur Fragezeichen; ein Hinweis darauf, dass der Browser die Symbole nicht darstellen kann.