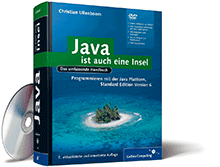3.4 Neue Objekte erzeugen 

Eine Klasse beschreibt also, wie ein Objekt aussehen soll. In einer Mengen- beziehungsweise Element-Beziehung ausgedrückt, entsprechen Objekte den Elementen und Klassen den Mengen, in denen die Objekte als Elemente enthalten sind. Diese Objekte haben Eigenschaften, die sich nutzen lassen. Wenn ein Punkt Koordinaten repräsentiert, wird es Möglichkeiten geben, diese Zustände zu erfragen und zu ändern.
Im Folgenden wollen wir untersuchen, wie sich von der Klasse Point zur Laufzeit Exemplare erzeugen lassen und wie der Zugriff auf die Eigenschaften der Point-Objekte aussieht.
3.4.1 Anlegen eines Exemplars einer Klasse mit dem new-Operator 

Objekte müssen in Java immer ausdrücklich erzeugt werden. Dazu definiert die Sprache den new-Operator.
|
new java.awt.Point(); |
Hinter dem new-Operator folgt der Name der Klasse, von der ein Exemplar erzeugt werden soll. Der Klassenname ist hier voll qualifiziert angegeben, da sich Point in einem Paket java.awt befindet. (Ein Paket ist eine Gruppe zusammengehöriger Klassen. Wir werden später mit den import-Anweisungen sehen, dass Entwickler diese Schreibweise auch abkürzen können.) Hinter dem Klassennamen folgt ein Paar runde Klammern für den Konstruktoraufruf. Dieser ist eine Art Methodenaufruf, über den sich Werte für die Initialisierung des frischen Objektes übergeben lassen.
Das Ergebnis des new-Operators ist eine Referenz auf das neue Objekt. Diese Referenz lässt sich zum Beispiel an eine Methode übergeben.
|
System.out.println( new java.awt.Point() ); |
Was passiert bei new?
Bekommt das Laufzeitsystem die Anfrage, ein Objekt mit new zu erzeugen, so reserviert es so viel Speicher, dass alle Objekt-Eigenschaften und Verwaltungsinformationen dort Platz haben. Ein Point-Objekt speichert die Koordinaten in zwei int-Werte, also sind mindestens 2 mal 4 Byte nötig. Den Speicherplatz nimmt die Laufzeitumgebung vom Heap. Der hat eine vordefinierte Maximalgröße, damit ein Java-Programm nicht beliebig viel Speicher vom Betriebssystem abgreifen kann, was die Maschine möglicherweise in den Ruin treibt. Ist das System nicht in der Lage, genügend Speicher bereitzustellen, wird der Garbage-Collector (GC) aufgerufen, um etwas aufzuräumen. Ist dann immer noch nicht ausreichend Speicher frei, generiert die Laufzeitumgebung einen OutOfMemoryError und bricht die Abarbeitung ab.
Konnte die Speicherverwaltung von Java freien Platz finden, ruft die Laufzeitumgebung den Konstruktor auf, der die Objektzustände initialisieren kann, und gibt anschließend eine Referenz auf das Objekt an das Programm zurück.
|
|
|
Des Weiteren kann auch die auf nativen Funktionen basierende Methode newInstance() vom Class- oder Constructor-Objekt ein neues Objekt erzeugen. Auch clone() aus Object kann ein neues Objekt als Kopie eines anderen Objekts erzeugen. |
3.4.2 Deklarieren von Referenzvariablen 

Mit new erzeugt das System das Objekt, aber die Referenz wird in der Regel zwischengespeichert, um fortlaufende Eigenschaften vom Objekt nutzen zu können.
|
java.awt.Point p; p = new java.awt.Point(); Die Typen müssen kompatibel sein! So ist es nicht möglich, wenn zum Beispiel die Variable p als String deklariert wäre. |
Den Verweis auf ein Objekt speichert eine Referenzvariable. Damit speichert eine Variable entweder einen einfachen Wert oder einen Verweis auf ein Objekt. Im Fall von lokalen Variablen ist auch eine Referenzvariable zu Beginn uninitialisiert. Würde es sich um eine Objekt- oder Klassenvariable handeln, wäre die Variable mit der Null-Referenz (null) initialisiert, die auf kein Objekt verweist.
Die Deklaration der Variablen p und die separate Erzeugung eines Exemplars der Klasse Point lassen sich, wie bei der Deklaration primitiver Datentypen, auch kombinieren.
|
double pi = 3.1415926535; java.awt.Point p = new java.awt.Point(); |
3.4.3 Zugriff auf Variablen und Methoden mit dem ».« 

Die in einer Klasse deklarierten Variablen heißen »Objektvariablen«, beziehungsweise »Exemplar-, Instanz- oder Ausprägungsvariablen«. Wird ein Objekt geschaffen, dann erhält es seinen eigenen Satz von Objektvariablen. [Es gibt auch den Fall, dass sich mehrere Objekte eine Variable teilen, so genannte statische Variablen. Diesen Fall werden wir später betrachten. ] Sie bilden den Zustand des Objekts.
Der Punktoperator ».« erlaubt auf Objekten den Zugriff auf die Methoden oder Variablen. Er steht zwischen einem Ausdruck, der eine Referenz zurückgibt, [Sprachlich wird diese Formulierung gerne mit »Rechts steht eine Referenz« abgekürzt. ] und der Objekteigenschaft. Welche Möglichkeiten eine Klasse genau gibt, erfährt der Entwickler in der API-Dokumentation.
|
java.awt.Point p = new java.awt.Point(); p.x = 12; p.y = 45 + p.x; |
Ein Methodenaufruf gestaltet sich genauso einfach wie ein Variablenzugriff. Hinter dem Ausdruck mit der Referenz folgt nach dem Punkt der Methodenname.
Das nachfolgende Beispiel erzeugt einen Punkt, belegt ihn mit Werten und gibt eine String-Repräsentation des Objektes aus.
Listing 3.1 MyPoint.java
class MyPoint
{
public static void main( String[] args )
{
java.awt.Point p = new java.awt.Point();
p.x = p.y = 12;
p.setLocation( -3, 2 );
System.out.println( p.toString() ); // java.awt.Point[x=-3,y=2]
// alternativ
// System.out.println( p );
}
}Die letzte Anweisung ist gültig, da println() jedes beliebige Objekt als Argument akzeptiert und auf diesem Objekt dann automatisch die toString()-Methode aufruft.
Abbildung 3.2 Die Abhängigkeit, dass MyPoint einen java.awt.Point nutzt, zeigt das UML-Diagramm mit einer gestrichelten Linie an. Die Parameterliste und Rückgabe sind in UML optional und hier nicht dargestellt.
Nach dem Punkt geht’s weiter
Die Funktion toString() liefert als Ergebnis ein String-Objekt, das den Zustand des Punkts preisgibt.
java.awt.Point p = new java.awt.Point(); String s = p.toString(); System.out.println( s ); // java.awt.Point[x=0,y=0]
Das String-Objekt besitzt selbst wieder Methoden. Eine davon ist length(), die die Länge der Zeichenkette liefert.
System.out.println( s.length() ); // 23
Das Erfragen des String-Objekts und dessen Länge können wir zu einer Anweisung verbinden – p sei wieder unser Point-Objekt:
System.out.println( p.toString().length() ); // 23
Objekterzeugung ohne Variablenzuweisung
Bei der Nutzung von Objekteigenschaften muss der Typ links vom Punkt immer eine Referenz sein. Im Prinzip funktioniert auch Folgendes:
new java.awt.Point().x = 1;
Dies ist hier allerdings unsinnig, da zwar das Objekt erzeugt und ein Attribut gesetzt wird, anschließend das Objekt aber für den Garbage-Collector wieder Freiwild ist. Interessant ist die Anwendung zum Beispiel bei einem File-Objekt, um etwa herauszufinden, wie groß eine Datei ist:
long size = new java.io.File( "file.txt" ).length();3.4.4 Konstruktoren nutzen 

Werden Objekte mit dem new-Operator angelegt, so wird ein Konstruktor aufgerufen, eine Art Methode mit besonderer Signatur. [Ein Konstruktor hat keinen Rückgabetyp und trägt auch denselben Namen wie die Klasse. ] Bei der Schaffung eines Objekts sollen in der Regel die Objektvariablen initialisiert werden. Diese Initialisierung wird dazu in den Konstruktor gesetzt, um sicherzustellen, dass das neue Objekt einen sinnvollen Anfangszustand aufweist.
Ein Konstruktor ohne Argumente ist der Standard-Konstruktor (auch »Default-Konstruktor«, selten auch »No-Arg-Konstruktor« genannt).
|
java.awt.Point p = new java.awt.Point(); p.setLocation( 10, 10 ); java.awt.Point q = new java.awt.Point( 10, 10 ); Der erste Konstruktor ist der Standard-Konstruktor, der zweite ein parametrisierter Konstruktor. |
3.4.5 Die API-Dokumentation 

Die wichtigste Informationsquelle für Programmierer ist die API-Dokumentation von Sun. Zu unserem Punkt können wir dort lesen, dass dieser eine Funktion setLocation() besitzt, die Variablen x und y definiert und einen Konstruktor anbietet, der zwei Ganzzahlen annimmt.
Die Dokumentation ist kein Teil der Standardinstallation einer Laufzeitumgebung – dafür ist die Hilfe zu groß. Wer über eine permanente Internetverbindung verfügt, kann die Dokumentation online unter http://tutego.com/go/javaapi lesen oder sie extra von der Sun-Seite http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp bei »Java SE 6 Documentation« herunterladen und als Sammlung von HTML-Dokumenten auspacken.
API-Dokumentation im HTML-Help Format
Die Sun-Dokumentation als Loseblattsammlung hat einen Nachteil, der sich im Programmieralltag bemerkbar macht: Sie lässt sich nur ungenügend durchsuchen. Da die Webseiten statisch sind, lässt sich nicht einfach nach Methoden forschen, die auf »listener« enden. Franck Allimant (http://tutego.com/go/allimant) übersetzt regelmäßig die HTML-Dokumentation von Sun in das Format Windows HTML-Help (CHM-Dateien), das auch unter Unix und Mac OS X mit der Open-Source-Software http://xchm.sourceforge.net/ gelesen werden kann. Neben den komprimierten Hilfe-Dateien lassen sich auch Sprach- und JVM-Spezifikation sowie die API-Dokumentation der Enterprise Edition und der Servlets im Speziellen beziehen.
Abbildung 3.3 API-Dokumentation mit der Windows-Hilfe